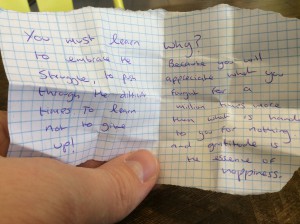Machen wir`s kurz: 2015 war im schlimm. Eine Achterbahnfahrt ohne Gurt. Da gab es natürlich Momente, in denen ich oben war. Aber eben nur kurz und dann auch noch kopfüber. Da braucht es eigentlich keinen Rückblick. Außerdem arbeite ich daran ja schon bruchstückhaft in diesem Blog, das hat sich auch heute wieder so ergeben. Diesmal sogar etwas mehr. Wer also nur wissen will, wo ich gerade so stecke, sollte nach dem folgenden Absatz aussteigen. Danach geht es nämlich nochmal ans Eingemachte. Deshalb sage ich auch an dieser Stelle schon Danke. Danke jedem, der in diesem schlimmen Jahr bei uns und bei mir war. Euch allen Glück und Gesundheit! Auf dass 2016 besser wird.

Einmal gründlich durchschütteln: Der JumpPark in Brno.
Heute habe ich Luftsprünge gemacht. Natürlich nicht vor Freude, sondern auf großen Trampolinen, im JumpPark in Brno. Kein schlechter Zeitvertreib für den Jahresausklang, so viel wusste ich. Denn ich war schon im September hier. Kurz nach der Trauerfeier war ich ja spontan ins Auto gestiegen und hatte eine ähnliche Tour unternommen, wie ich sie jetzt gerade mache. Da hatte ich zum ersten Mal den JumpPark für mich entdeckt und fand in der Hüpferei ein Mittel um mich selbst ein wenig selbst zu spüren. Zwei Mal war ich dann gleich dort. Diesmal war mein Besuch weniger für die Psyche notwendig, als für den Körper. Die letzten Tage haben ganz schön angesetzt – und nichts ist so fordernd, wie diese Trampoline. Anderthalb Liter Wasser habe ich heute binnen einer Stunde getrunken, wahrscheinlich aber zwei ausgeschwitzt. Und sonst? Prag blieb für mich diesmal unspektakulär, aber ein Ort zum Wohlfühlen. Meine Trauer ist noch ruhiger geworden.
Das gab mir die Möglichkeit, mich in den letzten Stunden dieses Jahres einmal den letzten Stunden von Johannes zu nähern. Die Erinnerungen daran sind die vielleicht schmerzhaftesten überhaupt, deshalb hatte ich bisher meist einen Bogen darum gemacht. Zum einen schmerzhaft, weil es schier unerträglich war, diesen geliebten Menschen leiden zu sehen. Den Verfall zu begleiten, scheinbar ohne noch einen Einfluss zu haben. Diese Hilflosigkeit. Seine Lebensfreude verlöschen zu sehen, die doch sonst stark genug war, um uns beide zu beflügeln.
Zum anderen, weil ich so verzweifelt wie erfolglos versucht habe, das Beste für ihn zu tun. Es ging schon seit dem Jahresanfang mit den medizinischen Entscheidungen los, die sich im nachhinein immer als die falschen erwiesen haben. Nein, ich mache mir keinen Vorwurf daraus. Tragisch bleibt es dennoch, dass wir die wachsenden Metastasen im Rückenmark lange übersehen hatten und die dadurch heikle Bestrahlung mit zu viel Kortison absichern mussten, das ihm wiederum übel zugesetzt hat. Dass niemand die scheußliche Lagerungswunde am Gesäß erkannt hat, die ihn monatelang peinigte. Dass wir wertvolle Zeit mit Avastin verloren haben, das bei ihm keinerlei Wirkung zeigte. Und dass wir schließlich zu spät auf das hoffnungsvolle CUSP9-Protokoll gesetzt haben.
So sind wir also immer hektischer den Entwicklungen hinterhergelaufen. Und wie schon an anderer Stelle gesagt: Dass es bald zuende gehen würde, war mir dabei viel zu lange nicht klar. Also waren wir, was uns beide angeht, auch darauf nicht vorbereitet. Als es unausweichlich wurde, lag Johannes schon im Krankenhaus – und nicht im Hospiz, wie wir Angehörigen es ihm gewünscht hätten. Und auch nicht zuhause, wie er selbst es sich gewünscht hatte. Einige Tage lang hatte ich es versucht und ihn in Vohwinkel gepflegt. Erstmals räumlich getrennt, er im Pflegebett in seinem Arbeitszimmer, ich in unserem Schlafzimmer. Die Klingel an seinem Bett war im Dauerbetrieb, ich damit auch. Alles war aus den Fugen geraten. Ständig gaben sich Pflegerinnen und Ärzte unsere Klinke in die Hand, dazwischen strapaziöse Toilettengänge, Essversuche, Schmerzattacken. Als die Schmerzen selbst mit aberwitzigen Medikamenten-Gaben nicht stabil in den Griff zu bekommen waren – zuletzt setzte ich sogar Spritzen – zogen wir die Reißleine und brachten ihn ins örtliche Krankenhaus. Es sollte nur eine Übergangsstation sein, um ihn etwas aufzupäppeln und die Schmerzmittel vernünftig einzustellen. Es wurden neun Nächte daraus, bis zu seinem Tod.
Natürlich drehte sich in den letzten Wochen ständig alles um seine Leiden und darum sie zu lindern. Dabei blieb dann aber wenig Raum und Kraft für uns, für so etwas wie die letzte große Aussprache. Immerhin: Sein Zimmer lag gleich neben der Palliativstation und deren Schwestern versorgten ihn mit. Außerdem wurden keine anderen Patienten in sein Zimmer gelegt. Ich durfte das freie Bett haben.
An einem Sonntag starb er. Eine Woche zuvor am Samstag kamen unsere Freunde aus Düsseldorf zu Besuch, mit denen wir in den vergangenen Jahren so viel gereist sind. Das machte ihn munter und zuversichtlich. Er bekam zu diesem Zeitpunkt erstmals niedrig dosiertes Morphium, kontinuierlich über eine Pumpe. Doch er war unternehmungslustig. Also setzten wir ihn in einen Rollstuhl, die Pumpe auf seinen Schoß – und los gings. Das war großartig: Ich durfte nochmal gemeinsam mit mit meinem geliebten Mann etwas erleben! Dass es nur der Klinik-Garten war, in den ich ihn schob, machte gar nichts. Im Gegenteil: Johannes mochte schon immer die Natur und freute sich nach den Tagen im Pflegebett so rührend über das Grün, den Blick auf den Teich und über alle Blüten, die wir ihm zum Schnuppern reichten. Es war das allerletzte Mal, das er glücklich wirkte. Wieder im Zimmer, verabschiedete er unsere Freunde mit einem Satz, der uns ins Mark fuhr: „Schön, dass ihr nochmal da wart.“
Am Dienstag meinte die Palliativschwester plötzlich, wir sollten unsere Betten doch zusammenrücken. Noch während ich zögerte, fing sie schon an umzuräumen und die Ritze zwischen den Betten mit einer gerollten Decke zu stopfen. Vor der Tür erklärte sie leise, dass sie nun den Eindruck habe, er werde in Kürze sterben, daher ihre Eile und Entschlossenheit. Sie drückte mir eine Broschüre über den Sterbeprozess in die Hand. Kaum hatte ich die paar Seiten neben Johannes liegend gelesen, ging es auch schon los. Er sagte etwas, wie: „Bitte bleibe jetzt bei mir!“ Nach zwei Tagen mit nur wenigen klaren Momenten wirkte er plötzlich wach, aber voller Angst. Ich sollte dabei sein, wenn er stirbt – das hatte er mir schow vor Tagen gesagt. Dass ich just in diesem Moment bei ihm sein sollte, konnte dann wohl nur eines heißen. Ich schickte die Nachtschwester, die irgendetwas wollte, wieder raus, sagte ihr, sie möge eine Stunde fernbleiben. Sie, ganz der Drache, fauchte erst, sah dann aber meinen Ernst und beließ es dabei.
Einen Moment später lagen Johannes und ich wieder Arm in Arm. Die letzte Gelegenheit für große Worte, dachte ich. Und auch seine Gedanken schienen in diese Richtung zu gehen. Schon etliche Wochen zuvor hatte ich ihn gebeten, ein Tondokument für mich aufzunehmen mit einer Botschaft, an die ich mich nach seinem Tod halten kann. Das hatte er zur Kenntnis genommen, war aber nicht mehr darauf eingegangen. Einerseits wusste ich zwar, dass er die wirklich wichtigen Dinge nie vergisst, andererseits war er ja nicht bei Kräften, immer nur mit der Krankheit beschäftigt. In jenem Moment in der Klinik, als wir beide an sein Sterben dachten, aneinander geklammert, kam es also plötzlich zu folgendem Dialog (den ich wenig später aufgeschrieben habe):
Er: Scheiße, ich habe vergessen, die Kassette für Dich zu besprechen!
Ich: Was hättest Du mir denn sagen wollen?
Er: Dass ich Dich über alles liebe. Dass Du der beste Ehemann bist, den ich mir wünschen konnte. Und dass Du Dich so wunderbar um mich gekümmert hast.
(Pause)
Er: Es tut mir so leid. So sollte es nicht enden.
Ich: Aber wir haben immer das Beste aus allem gemacht.
Er: Oh ja, wir haben das Beste daraus gemacht.
Ich: Meine glücklichste Zeit mit Dir war die kurz vor der Krankheit. Aber gleich danach kommt die Zeit der Krankheit. Das war so schön, wir haben so viel erlebt und uns so viel Zuneigung gegeben… Danke.
Ich (entdecke eine Träne in seinem Augenwinkel, erstmals in zwölf Jahren, sage spaßhaft): Oh, Du weinst ja doch – dass ich das noch erleben darf.
Er (flüstert): Erwischt.
Dieser Moment mit ihm ist mir unendlich wichtig. Es waren Worte, die immer in der Luft lagen, aber eben nie ausgesprochen wurden. Lieber nach vorne schauen. Gerade keine Zeit dafür. Wir wissen doch, dass wir uns lieben. So kam es nie dazu.
Es gab noch einen weiteren Schlüsselmoment am Sterbebett. Leiner einen mit bitterem Beigeschmack. Denn an jenem Dienstagabend ist er einfach nur weggedämmert, während ich aufgewühlt und ängstlich neben ihm lag und seinen Schlaf bewachte. Am Freitag darauf war das Morphium bereits merklich erhöht worden, erstmals sollte er außerdem ein Sedativum bekommen, ebenfalls mit der Pumpe. Schlafen zu dürfen, schien ihm inzwischen sehr recht zu sein, das Lebenslicht flackerte nur noch klein und schwach. Den Tag über war es überraschend nochmal aufgeflammt, da hatte er nachmittags plötzlich seine Eltern bei sich haben wollen um sich zu verabschieden. Hat seinen besten Freund angerufen. Der saß zwar noch morgens im Krankenhaus an seinem Bett, doch daran konnte Johannes sich nicht erinnern. Für ihn war eben genau in diesem Moment der Zeitpunkt gekommen.
Tja, und dann war es Abend, gegen 19 Uhr, und er sollte mit dem zweiten Medikament schlafen. Vielleicht nie wieder aufwachen. Ein „vielleicht“, das mich wahnsinnig machte, weil ich ihn natürlich bei mir haben wollte, nichts mehr fürchtete als seinen Tod – und weil ich nicht wusste, wann es wirklich Zeit ist, sich zu verabschieden. In diesem Punkt hat er mir eigentlich geholfen – wenn ich die Signale denn aufgenommen hätte. Er bat mich nämlich erneut, bei ihm zu bleiben bis er schläft.
Ich telefonierte noch schnell mit seinen Eltern, mit denen ich während dieser Tage abends oft ein, zwei Stunden lang in der Nähe Essen ging. Eine kleine Auszeit mit jenen Menschen, die Johannes und mir am nächsten standen. Dieses Ritual war mir wichtig, auch an diesem besonders schweren Tag. Ich sagte ihnen, dass wir wohl gegen 20 Uhr essen gehen könnten. Bis dahin, war ich mir sicher, würde Johannes längst schlafen.
Dann saß ich auf der Bettkante und hielt seine Hand. Es gab nichts mehr zu sagen, die Hand zu halten war für uns beide genug. Oder auch nicht: Er richtete sein eines Auge (das andere war zugequollen) auf mich und deutete an, dass er einen Kuss haben will. Also haben wir uns geküsst. Hauptsächlich ich ihn. Dann haben wir wieder Hände gehalten. Nur einschlafen konnte er nicht, obwohl die Dosierung schon erhöht worden war. Klammerte er sich an dieses letzte Stück Leben? Diesen letzten wachen Augenblick? Ich wagte das so Naheliegende einfach nicht zu denken. Und selbst jetzt, da ich es schreibe, kommen mir die Tränen.
Nach einer Stunde an seiner Bettkante habe ich es nicht mehr ausgehalten. Das Sitzen. Die Situation. Es schien fast, dass er nicht schlafen konnte, genau weil ich dort saß. Unsicher, wie sehr er schon dämmerte, habe ich dann leise gesagt, dass ich nun mit seinen Eltern essen gehen würde und danach wieder bei ihm sei. Darauf habe ich mich davongeschlichen. Er sah so aus, als würde er mir aus dem Halbdunkel des Raumes nachblicken, wie ich aus der Tür ging. Doch zurück konnte ich auch nicht mehr. Danach habe ich mich so richtig mies gefühlt, als ob ich ein großes, wichtiges Versprechen gebrochen hätte. Klar, ich war die allermeiste Zeit in diesen neun Tagen und Nächten bei ihm. Auch in wertvollen Momenten. Aber in diesem nicht so ganz. Das wurmt mich.
Am nächsten Tag kam er nur kurz und wenig zu Bewusstsein. Wir hatten das Sedativum etwas abgedreht. Er schien dafür gar nicht dankbar zu sein und wollte schleunigst wieder abtauchen. Durfte er auch. Am Sonntagmittag war es dann so weit. Ich will oder kann über diesen letzten Moment nicht schreiben (und liebe Claudia: die Bilder davon bleiben freilich unter Verschluss), nur so viel: Es war ein leiser Moment – und ich war, so wie er es wollte, bei ihm.
 Ich weiß auch genau, was der Auslöser war. Gestern ist meine Schwiegermutter nämlich mit mir zu Henner Gräf gefahren, einem Steinmetz in Sprockhövel. Wir suchten Inspiration für ein Denkmal, das auf Johannes Grab noch fehlt. So viel ist klar: Ein dunkler, kantiger Stein mit aufgesetzten Bronzelettern wird es nicht. Ein Holzobjekt, wie mir zeitweise vorschwebte, wohl auch eher nicht. Henner Gräf war für diesen Fall wohl genau der richtige, da er sich nicht nur als Handwerker alter Schule sondern auch als Bildhauer begreift. Er hat wirklich tolle Ideen für Gräber entwickelt und sich damit einen großen Ruf erworben. Bettina und ich sind also zwischen rohen und behauenen Steinen herumgeschlendert die überall auf seinem Gelände lagern. Vor seiner Werkstatt klopfte er derweil selbst auf einem Stein, eine schöne Szene in der kalten, klaren Luft unter der niedrig stehenden Sonne. Als wir dann etwas mit ihm sprachen, fragte er auch, was Johannes denn für ein Mensch gewesen sei. Ich merkte: Jetzt kommt es drauf an, mit ein, zwei Sätzen den richtigen Impuls für den Künstler zu geben. Was hat also Johannes ausgemacht? Das zu erfühlen, hat mich fast umgehauen und es fiel mir schwer, überhaupt ein Wort herauszubringen.
Ich weiß auch genau, was der Auslöser war. Gestern ist meine Schwiegermutter nämlich mit mir zu Henner Gräf gefahren, einem Steinmetz in Sprockhövel. Wir suchten Inspiration für ein Denkmal, das auf Johannes Grab noch fehlt. So viel ist klar: Ein dunkler, kantiger Stein mit aufgesetzten Bronzelettern wird es nicht. Ein Holzobjekt, wie mir zeitweise vorschwebte, wohl auch eher nicht. Henner Gräf war für diesen Fall wohl genau der richtige, da er sich nicht nur als Handwerker alter Schule sondern auch als Bildhauer begreift. Er hat wirklich tolle Ideen für Gräber entwickelt und sich damit einen großen Ruf erworben. Bettina und ich sind also zwischen rohen und behauenen Steinen herumgeschlendert die überall auf seinem Gelände lagern. Vor seiner Werkstatt klopfte er derweil selbst auf einem Stein, eine schöne Szene in der kalten, klaren Luft unter der niedrig stehenden Sonne. Als wir dann etwas mit ihm sprachen, fragte er auch, was Johannes denn für ein Mensch gewesen sei. Ich merkte: Jetzt kommt es drauf an, mit ein, zwei Sätzen den richtigen Impuls für den Künstler zu geben. Was hat also Johannes ausgemacht? Das zu erfühlen, hat mich fast umgehauen und es fiel mir schwer, überhaupt ein Wort herauszubringen.